Vom Kreditvertrag bis zur Kontoeröffnung – immer mehr Geschäfte werden online abgeschlossen. Vor allem Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche zögern allerdings, ihre Kunden Verträge digital signieren zu lassen. Zu groß die Sorge, dass die Unterschrift vor Gericht nicht Bestand hat. Wir erklären, was Unternehmen wissen müssen, damit sie eine optimale Customer Experience anbieten und sich auf die Rechtsgültigkeit ihrer Verträge verlassen können.
Was ist eine digitale Unterschrift?
Eine digitale Unterschrift ist eine elektronische Methode zur Authentifizierung und Bestätigung der Integrität eines Dokuments oder einer Nachricht. Sie dient dazu sicherzustellen, dass das Dokument nicht verändert wurde und dass die Person, die es signiert hat, tatsächlich diejenige ist, die sie vorgibt zu sein. Eine digitale Unterschrift basiert auf kryptografischen Techniken und verwendet mathematische Algorithmen, um diese Sicherheitsmerkmale zu gewährleisten.
Werden digitale Unterschriften anerkannt?
- Ja, prinzipiell kann die elektronische Unterschrift die herkömmliche handschriftliche Unterschrift (mit Ausnahmen) ersetzen.
- Die Gültigkeit einer digitalen Unterschrift und ihre Beweiskraft unterscheidet sich nach verwendeter Signaturmethode, zwischen Ländern und je nach Anwendungsgebiet.
- Auf EU-Ebene setzt die eIDAS-Verordnung den Rechtsrahmen zur Verwendung von elektronischen Signaturen und sieht drei Arten von Signaturen vor.
- Die meisten Verträge unterliegen der „Formfreiheit“, was bedeutet, dass sie mit jeglicher Art von digitaler Unterschrift rechtsgültig sind.
- Dokumente, welche gesetzlich die Schriftform erfordern, sind ausschließlich rechtsgültig, wenn sie mit dem E-Signatur-Standard der qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet sind.
- Zusätzlich gibt es einige wenige Dokumente, bei denen die Verwendung der elektronischen Form gänzlich untersagt ist, wie zum Beispiel die Beendigung oder Hinterlegung einer Bürgschaft.
Die rechtliche Handhabung der elektronischen Signatur in der Europäischen Union
Die eIDAS-Verordnung definiert drei Arten von elektronischen Signaturen und macht klare Vorgaben, welche technischen und weiteren Voraussetzungen die Signaturmethoden erfüllen müssen. Sie klärt, welche Beweiskraft die verschiedenen Methoden haben und für welche Vertragsfälle sie geeignet sind. Ein Schriftstück, das diese Signatur trägt, kann vor Gericht als Beweismittel verwendet werden.
Nationale Gesetzgebungen ergänzen und unterstützen die rechtliche Einordnung der elektronischen Unterschriften.
In Deutschland betont das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in §126a beispielsweise die Rolle der qualifizierten elektronischen Signatur für Rechtsdokumente, die andernfalls der Schriftform bedürfen. Das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) verweist ebenfalls auf die Notwendigkeit der qualifizierten elektronischen Signatur in Verwaltungsverfahren. Das Vertrauensdienstegesetz (VDG) regelt die Anforderungen an Vertrauensdiensteanbieter (Zertifizierungsstellen) und qualifizierte elektronische Signaturen.
Klarer Rechtsrahmen beschleunigt Wandel zu digitalen Vertragsprozessen
Die klaren rechtlichen Rahmenbedingungen, die in den vergangenen Jahren für digitale Unterschriften geschaffen wurden, haben die Akzeptanz und Verwendung sowohl innerhalb Deutschlands als auch innerhalb der EU beschleunigt.
Immer mehr Unternehmen lösen sich von papiergebundenen Prozessen und digitalisieren auch unterschriftenbezogene Vorgänge. Technische Hürden sind minimal. Cloudbasierte Anwendungen zur digitalen Signatur sind mittlerweile performant, sicher und für Kunden intuitiv zu bedienen. Sie sind die Katalysatoren der Entwicklung: Die Analysten von MarketsandMarkets schätzen, dass der Markt von 5,5 Milliarden US-Dollar (2022) bis 2027 auf 25,2 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Vor allem Anbieter von Finanz- und Versicherungsprodukten sehen die Chance, mit rechtsgültigen elektronischen Signaturen ihre Abschlussquote zu erhöhen: An die Stelle eines persönlichen Termins oder des PostIdent-Verfahrens tritt das AutoIdent– oder VideoIdent-Verfahren plus digitale Signatur. Für Kunden verkürzt sich der Weg zu Kauf oder Kredit auf wenige Minuten.
Nicht jede digitale Unterschrift ist rechtssicher
Je nachdem, wie eine elektronische Signatur erstellt wird, variiert allerdings ihre Beweiskraft und kommen andere Anwendungsgebiete in Frage. In der EU gilt die eIDAS-Verordnung, die drei Arten von elektronischen Signaturen unterscheidet. Beweiskraft meint hier: Ein Schriftstück bzw. Dokument, das diese Signatur trägt, kann vor Gericht als Beweismittel verwendet werden.
Einfache elektronische Signatur (EES)
Die einfachste Form der digitalen Unterschrift ist die einfache elektronische Signatur. Hier bestehen keine besonderen technischen Anforderungen. Die Unterschrift muss nur mit dem unterschriebenen Dokument „logisch verknüpft“ sein. Es reicht zum Beispiel, eine handschriftliche Unterschrift einzuscannen und in ein digitales Dokument einzufügen.
Fortgeschrittene elektronische Signatur (AES/FES)
Im Gegensatz zur einfachen Signatur muss die fortgeschrittene elektronische Signatur (Advanced Electronic Signature: AES) nach eIDAS klar definierte technische Anforderungen erfüllen:
- Identifizierung des Unterzeichners muss möglich sein
- Klare Zuordnung der Signatur zum Unterzeichner
- Mit Verschlüsselungstechnologien erstellt, die der alleinigen Kontrolle des Unterzeichners unterliegen
- Signatur ist so mit dem Dokument verbunden, dass nachträgliche Manipulation erkennbar wäre
Um die Anforderungen der FES zu erfüllen, kommt spezielle E-Signatur-Software zum Einsatz, die mit asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren (Private-Key-Infrastructure) arbeitet.
Qualifizierte elektronische Signatur (QES)
Die qualifizierte elektronische Signatur ist die sicherste Form der digitalen Unterschrift. Sie muss neben den technischen Anforderungen, die an eine FES gestellt werden, weitere technische Voraussetzungen erfüllen. Beispielsweise muss die Signatur nicht nur verschlüsselt werden, sondern auch ein qualifiziertes Sicherheitszertifikat beinhalten. Diese Zertifikate können nur staatlich anerkannten Zertifizierungsstellen vergeben. Außerdem muss eine Identitätsprüfung des Unterzeichners durch E-ID oder Video stattfinden.
Trotz der komplexen Technologie im Hintergrund bleibt der Einsatz der QES für Anwender einfach: Wer seinen Kunden die Unterschrift via QES anbieten will, wendet sich an einen E-Signaturanbieter wie IDnow, der mit einer staatlich anerkannten Zertifizierungsstelle zusammenarbeitet und bei der Integration der Signatur-Software in die eigenen Workflows unterstützt.
Wann ist die qualifizierte, wann die fortgeschrittene, wann die einfache elektronische Signatur rechtsgültig?
Die einfache elektronische Signatur ist vergleichbar mit einem digitalen Handschlag unter Kaufleuten. Sie ist rechtsgültig bei Dokumenten, bei denen das Gesetz keine Schriftform vorsieht. Wegen ihrer geringen Fälschungssicherheit ist die EES aber nur für Vorgänge mit geringem Haftungsrisiko empfohlen. Rechtsgültig meint hier: Aus rechtlicher Perspektive ist ein Dokument mit dieser Unterschrift wirksam bzw. gültig.
Beispiele: Kostenvoranschläge, Bestellungen und Aufträge, Geheimhaltungserklärungen
Die fortgeschrittene elektronische Signatur ist rechtsgültig und für die meisten Vertragsarten ausreichend. Wie bei der EES gilt auch hier: Sie ist geeignet für Dokumente, die keine Schriftform erfordern. Allerdings ist ihre Beweiskraft wegen der eingesetzten Verschlüsselung vor Gericht deutlich höher das die der EES.
Beispiele: Kaufvertrag über bewegliche Güter, Mietvertrag, Personenversicherung, Gesellschaftsvertrag
Die qualifizierte elektronische Signatur ist die digitale Signatur mit der höchsten Rechtssicherheit. Aufgrund der hohen Sicherheitsstandards ist die QES gesetzlich der handschriftlichen Unterschrift auf Papier gleichgestellt. Sie hat die gleiche Beweiskraft vor Gericht und kann daher auch für Dokumente mit Schriftformerfordernis und hohem Haftungsrisiko eingesetzt werden.
Beispiele: Konto- und Depoteröffnung, Verbraucherdarlehensvertrag, Konsumkreditvertrag
In einigen wenigen Fällen müssen Dokumente weiterhin handschriftlich auf Papier signiert werden, zum Beispiel Testamente oder Kündigungen von Arbeitsverhältnissen.
eSign – Digitale Verträge rechtssicher unterzeichnen.

Welche Signatur passt zum jeweiligen Anwendungsfall?
Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet voran. Gleichzeitig verändern sich die Erwartungen, wie effizient Prozesse sein sollten. Unternehmen und Behörden stehen unter Druck ihren Kunden komfortable digitale Lösungen anzubieten, um schneller und zeitgemäßer zu agieren.
Digitale Unterschriften sind ein wichtiger Baustein, wenn Unternehmen den Anschluss an die digitale Entwicklung halten und sich kundenzentriert aufstellen möchten. Dank E-Signatur-Anbietern lassen sich die Workflows ohne immensen internen Aufwand anpassen.
Vor allem die qualifizierte elektronische Unterschrift ist ein Game Changer: Auch sensible Vertragsprozesse zu Versicherungen und Finanzen lassen sich jetzt komplett digital abbilden. Der Weg zum Vertragsschluss beschleunigt sich um ein Vielfaches, ohne dass die Rechtssicherheit sinkt. Für Unternehmen eröffnen sich so ganz neue Wachstumschancen.
Einfach rechtsgültig digital unterzeichnen. Mit IDnow eSign.
Weitere Fragen zum Thema elektronische Signaturen:
Ist eine PDF-Unterschrift rechtsgültig?
Ein PDF-Dokument kann auf unterschiedliche Weise digital unterschrieben werden. Alle drei in der EU geltenden E-Signatur-Standards – einfache elektronische Signatur, fortgeschrittene elektronische Signatur und qualifizierte elektronische Signatur (QES) – lassen sich bei PDF-Dokumenten einsetzen. In unserem Ratgeber lesen Sie, wie Sie die verschiedenen PDF-Unterschriften einfach in die Dokumente integrieren.
Welche Art der Signatur rechtsgültig ist, hängt von der Art des Rechtsgeschäfts bzw. Dokuments ab. Wenn Sie mithilfe einer E-Signaturlösung eine QES in ein PDF-Dokument einfügen, entspricht die Unterschrift in Rechtsgültigkeit und Beweiskraft der einer handschriftlichen Signatur auf Papier.
Wie kann ich digital unterschreiben?
Für einfache Verträge mit geringem Haftungsrisiko, bei denen keine Schriftform erforderlich ist, reicht es aus, eine handschriftliche Unterschrift einzuscannen und in ein digitales Dokument einzufügen.
Eine höhere Rechtssicherheit bieten die fortgeschrittene und die qualifizierte elektronische Signatur. Um sie einzusetzen, können Unternehmen sich an E-Signatur-Anbieter wie IDnow wenden.
Ist eine eingescannte Unterschrift rechtsgültig?
Für die meisten Verträge fordert der Gesetzgeber keine spezielle Form, damit sie rechtsgültig sind. Besteht diese Formfreiheit, reicht es aus, das Dokument mit einer eingescannten Unterschrift zu signieren.
Um die Echtheit der Unterschrift jedoch vor Gericht beweisen zu können, kann es auch ohne Formvorgaben sinnvoll sein, eine fortgeschrittene elektronische Signatur oder qualifizierte elektronische Signatur zu verwenden.
Welche Dokumente dürfen nicht digital unterschrieben werden?
In bestimmten Fällen verlangt das Gesetz, dass Dokumente eine physische Unterschrift tragen müssen, damit sie rechtsverbindlich sind. Dazu gehören Mietverträge mit einer Laufzeit von einem Jahr oder mehr und Bürgschaften von natürlichen Personen sowie Schuldversprechen und Anerkenntnisse, die durch Vertrag abgegeben werden sowie u.a. Aufhebungsverträge, Betriebsvereinbarungen, Arbeitnehmerüberlassungen, Sozialpläne, Kündigungsschreiben, Arbeitszeugnisse, Zeugniserteilungen und Interessensausgleiche. Elektronische Unterschriften werden hier nicht akzeptiert; sondern nur die Schriftform, die den gesetzlichen Anforderungen genügt.
Ist die digitale Unterschrift rechtssicher?
Digitale Signaturen bzw. digitale Unterschriften sind in vielen Ländern weltweit rechtsgültig, als Beweismittel vor Gericht anerkannt und daher rechtskräftig. Dank der europäischen eIDAS-Verordnung, die seit Juli 2016 in ganz Europa gilt, ist die elektronische Unterschrift anerkannt und standardisiert:
„Die Rechtsgültigkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur entspricht jener einer handschriftlichen Unterschrift.“ (Artikel 25 – 2.)
Dies beseitigt jegliche Rechtsunsicherheit, und es steht nun schwarz auf weiß fest, dass eine elektronische Signatur einer handschriftlichen Unterschrift völlig gleichkommt. Die Beweiskraft der elektronischen Signatur ist daher gewährleistet, solange sie unter Verwendung eines zertifizierten und vertrauenswürdigen Dienstleisters erfolgt.Mehr auf unserer Übersichtsseite Was ist eine digitale Signatur?
Wann ist eine digitale Unterschrift nicht gültig?
Generell gilt: Eine digitale Unterschrift ist ungültig, sobald der Gesetzgeber die elektronische Form für ein Dokument ausdrücklich ausschließt. Es gibt jedoch bestimmte Situationen, in denen eine digitale Unterschrift als nicht gültig angesehen werden kann. Hier sind einige Gründe, aus denen eine digitale Unterschrift möglicherweise nicht als gültig angesehen wird:
1. Fehlende Zustimmung: Eine digitale Unterschrift ist nur dann gültig, wenn die Person, die sie geleistet hat, ihre ausdrückliche Zustimmung dazu gegeben hat. Wenn die Zustimmung nicht gegeben wurde oder unter Zwang erfolgte, kann die Unterschrift für ungültig erklärt werden.
2. Fälschung: Wenn jemand die digitale Unterschrift einer anderen Person ohne deren Zustimmung erstellt oder manipuliert, handelt es sich um eine Fälschung und die Unterschrift ist nicht gültig.
3. Verstoß gegen Gesetze und Vorschriften: Wenn die Art und Weise, wie die digitale Unterschrift erstellt wurde, gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt, kann dies zu ihrer Ungültigkeit führen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn bestimmte Identifizierungsanforderungen nicht erfüllt sind.
4. Mangel an Authentifizierung: Eine digitale Unterschrift muss die Identität der Person, die sie geleistet hat, eindeutig nachweisen. Wenn es keine ausreichenden Maßnahmen zur Authentifizierung gibt und es daher Zweifel an der Identität gibt, kann die Unterschrift nicht als gültig angesehen werden.
5. Technische Mängel: Wenn bei der Erstellung der digitalen Unterschrift technische Fehler oder Schwachstellen aufgetreten sind, die die Integrität oder Sicherheit der Unterschrift beeinträchtigen, kann dies zu ihrer Ungültigkeit führen.
6. Ungültiges Zertifikat: In Fällen, in denen digitale Signaturen auf Zertifikaten basieren, kann ein abgelaufenes oder widerrufenes Zertifikat die Gültigkeit der Unterschrift beeinträchtigen.
Von
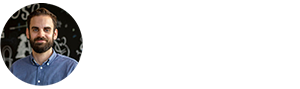
Jonathan Bluemel
Senior Content & SEO Manager bei IDnow
Jetzt mit Jonathan auf LinkedIn vernetzen



